Die Fachgruppe Ornithologie des NABU Jena
... ist offen für ornithologisch Interessierte, die den Codex der FG anerkennen und ausführen
... stellt an neu Hinzukommende keine Bedingungen zu Kenntnissen oder Mitgliedschaften
... hat Chat-Gruppen (Signal + WhatsApp) zu lokalen ornith. Themen (bei Interesse an Leitung wenden)
... gestaltet Themen-Vorträge und unternimmt Exkursionen (s.u. bzw. NABU-Programm)
... betreut Kartierungen, Wasservogelzählungen, Nisthilfeprojekte etc. ehrenamtlich
... ist vernetzt mit überregionalen ornithologischen Institutionen: u.a. Verein Thüringer Ornithologen (VTO), Dachverband Deutscher Avifaunisten (DDA)
... ist beratend tätig für ökologisch-avifaunistische Fragestellungen
... fertigt wissenschaftlich fundierte Expertisen und Dokumentationen an (u.a. MhB)
... dokumentiert ausgewählte Aktivitäten im Logbuch der Fachgruppe
... wird geleitet von Holger Kirschner aus Jena: ornithologie@nabu-jena.de
Vogel der Monate Januar & Februar 2026 - Rebhuhn

Das Rebhuhn ist der Vogel der Monate Januar und Februar 2026, auch des Jahres 2026. Im Februar werden wieder die Rebhuhnzählungen gestartet. Gezählt wird auf sogenannten Transekten. Dies sind vorgegebenen Abschnitte in der Feldflur, ca. 500 m lang. Ziel ist es, bundesweit den Rebhuhnbestand zu ergründen, auch um Aktionen wie z.B. Blühstreifen oder Prädatoren-Bejagung in ihrer Wirksamkeit zu bewerten. Dem Rebhuhnbestand setzen intensive Landwirtschaft und totgespritzte Felder, auch das Fehlen von Hecken u.a. arg zu. Insofern ist es zu begrüßen, dass ein vielschichtiges Engagement diese heimische Art schützen und fördern möchte.
https://www.stiftung-lebensraum-thueringen.de
Der wissenschaftliche Name Perdix steht sowohl im Griechischen als auch im Lateinischen für „Rebhuhn“. Im Deutschen wird der Ruf des Rebhuhns mit zur Namensgebung beigetragen haben: Rrrrrrrrrrrrrep.
Auf den Feldern um Jena gibt es immer wieder Rebhuhnsichtungen. Im Winter schließen sich Rebhühner oft in größeren Trupps zusammen. Die Paarbildung findet im Februar/März statt.
Also, wer Lust hat bei den Rebhuhnzählungen mit zu wirken, schreibt einfach eine Nachricht an ornithologie@nabu-jena.de
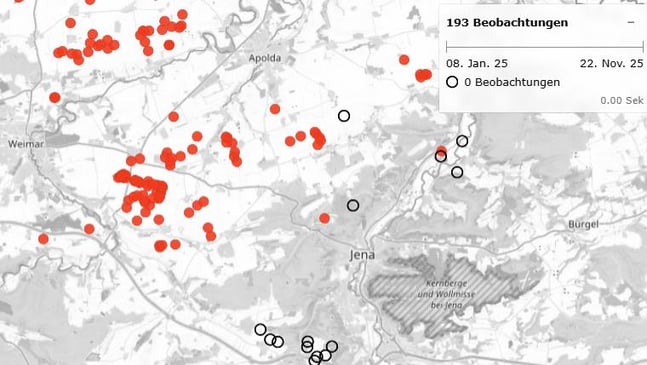
Abb. aus Ornitho.de
Rehuhn-Meldungen in 2025, Bildausschnitt
Ornithologie!
... ein wichtiges und wunderbares Betätigungsfeld
Wichtig, weil:
... sie als Bestandteil der Zoologie ökologische Zusammenhänge erkundet, denen auch der Mensch letztendlich vollständig ausgeliefert ist,
... ihr ein seismographischer Charakter zukommt bezogen auf die Auswirkungen menschlicher Eingriffe in die Natur,
... ein jeder auch noch so geringe Beitrag wichtig ist für die Vogelwelt, für die Natur.
Wunderbar, weil:
... sie zu jeder Tages- und Nachtzeit und an allen Orten der Erde betrieben werden kann,
... es Freude bereitet, in der Natur – als Teil von ihr – unterwegs zu sein, sie zu entdecken und sich von ihren Schönheiten faszinieren zu lassen,
... Vögel in ihrer Artenvielfalt mit ihren Federkleidern, ihrem Gesang, ihren Rufen und ihrem Verhalten sich meist sehr gut beobachten und studieren lassen – ganz gleich ob am Futterhaus vorm Fenster, bei Spaziergängen, auf dem Weg zur Arbeit, bei Ausflügen oder Exkursionen,
... sie unabhängig von Anspruch, Wissens- und Erfahrungsstand von jeder und jedem aus jeglicher Altersgruppe ausgeübt werden kann.
Mitmachen lohnt sich!
Nächste Termine
Alle Veranstaltungen sind offen. Es bedarf keiner Anmeldung. Der Eintritt ist frei .
Alle Vorträge 20.00 Uhr, SR 306, Eintritt frei – keine Anmeldung erforderlich;
Wasservogelzählung ist Sonntags, falls von Streckenführungen nicht anders vereinbart: 7 Strecken von querfeldein bis bequem in Kleingruppen entlang der Saale
Do 15.01.2026
Aus der Vogelwelt IRlands
Hugo Billert / Jena
20:00 Uhr Seminarraum 306, Uni-Jena, Zeiss-Campus
So 18.01.2025
Wasservogelzählung entlang der Saale - Wandern und Kennenlernen: Gegend, Vögel, Leute
Bitte mit Fachgruppenleitung in Verbindung setzen: ornithologie@nabu-jena.de
Do 29.01.2026
Aus der Vogelwelt Südwest-Europas
Carsten Stiller / Jena
20:00 Uhr Seminarraum 306, Uni-Jena, Zeiss-Campus
Do 12.02.2026
Nisthilfen - Hinweise zu Bau, Pflegen, Position u.a.
Workshop: Stefan Schießl+AG Nisthilfen
20:00 Uhr Seminarraum 306, Uni-Jena, Zeiss-Campus
Do 26.02.2026
Vogelstimmen-Lernen lernen 1
Holger Kirschner / Jena
20:00 Uhr Seminarraum 306, Uni-Jena, Zeiss-Campus
Ziel: selbständiges Lernen der Vogellaute zur Bestimmung der Vogelart. Es geht eingangs um Merkmale wie z.B. Tonhöhe, Strophen- und Pausenlänge, Tonsequenz-Eigenschaften (abfallend, gleichbleibend, aufsteigend), Tonstärke usw. Anschließend gibt es Erfahrungen aus Theorie (u.a. Medien) und Praxis (auffällige Vögel/Merkmale etc.). Hand-outs werden verteilt.
Do 12.03.2026
Vogelstimmen-Lernen lernen 2
Vertiefung individueller Methoden + Material für einen gelingenden Einstieg
Holger Kirschner / Jena
20:00 Uhr Seminarraum 306, Uni-Jena, Zeiss-Campus
Wiederholung und Vertiefung: Es werden Beispiele zur Charakterisierung von Gesängen/Lauten behandelt und vertieft. Zudem werden lokal häufige Arten vorgestellt und den jeweiligen Lebensräumen zugeordnet. Schließlich werden zur Anregung Erfahrungen unterschiedlicher Interessenten ausgetauscht. Hand-outs werden verteilt.
So 15.03.2025
Wasservogelzählung entlang der Saale - Wandern und Kennenlernen: Gegend, Vögel, Leute
Bitte mit Fachgruppenleitung in Verbindung setzen: ornithologie@nabu-jena.de
Do 26.03.2026
Wildvogelhilfe Jena – Rückblicke, Einblicke, Ausblicke
Anna-Josefine Sonntag & Co. / Jena
20:00 Uhr Seminarraum 306, Uni-Jena, Zeiss-Campus
Do 23.04.2026
Schnupperexkursion 01 - für Einsteigende und Neugierige
18.00 Uhr Grießbrücke / Jena
Keine Anmeldung erforderlich
Do 07.05.2026
Schnupperexkursion 02 - für Einsteigende und Neugierige
18.00 Uhr Grießbrücke / Jena
Keine Anmeldung erforderlich
Do 21.05.2026
Schnupperexkursion 03 - für Einsteigende und Neugierige
18.00 Uhr Parkplatz Closewitzer Wäldchen/Windknollen
Keine Anmeldung erforderlich
Do 04.06.2026
Exkursion zu dem Kiesteichen bei Orlamünde
19.00 Uhr am Bahnhof Orlamünde
Keine Anmeldung erforderlich
Do 18.06.2026
Exkursion zum TÜP Rothenstein
19.00 Uhr am Schießplatz
Keine Anmeldung erforderlich
Fr 28.08.2026
Exkursion auf der Lehnstedter Höhe
18.30 Uhr am Parkplatz neben Speicher Lehnstedt
Bitte mit Fachgruppenleitung in Verbindung setzen: ornithologie@nabu-jena.de
Do 10.09.2026
Exkursion zum Hainspitzer See
18.00 Uhr am Hainspitzer See
Keine Anmeldung erforderlich
Do 24.09.2026
Fachgruppenmitglieder berichten aus 2026
Bitte mit Fachgruppenleitung in Verbindung setzen: ornithologie@nabu-jena.de
20:00 Uhr Seminarraum 306, Uni-Jena, Zeiss-Campus
Do 08.10.2026
Aus der Vogelwelt Ecuadors
Falco Beutler / Jena
20:00 Uhr Seminarraum 306, Uni-Jena, Zeiss-Campus
Do 05.11.2026
Einstieg in die Ornithologie 1 – die ersten drei Meter einer spannenden Entdeckungsreise
Holger Kirschner / Jena
20:00 Uhr Seminarraum 306, Uni-Jena, Zeiss-Campus
Einerseits fasziniert die Vogelwelt, andererseits kann die anfangs kaum überschaubare Artenvielfalt demotivierend sein beim Kennenlernen. Wo kann wie angefangen werden, um etwas je nach persönlichen Interessen zu entwickeln? Möglichkeiten eines gelingenden Einstiegs werden aufgezeigt.
So 15.11.2026
Wasservogelzählung entlang der Saale - Wandern und Kennenlernen: Gegend, Vögel, Leute
Bitte mit Fachgruppenleitung in Verbindung setzen: ornithologie@nabu-jena.de
Do 19.11.2026
Einstieg in die Ornithologie 2 – die zweiten drei Meter einer spannenden Entdeckungsreise + Tipps zu Spots in/um Jena
Holger Kirschner / Jena
20:00 Uhr Seminarraum 306, Uni-Jena, Zeiss-Campus
Gegeben werden Hinweise zur Vogelwelt in und um Jena, zu Beobachtungsstellen, zu geeigneten Werkzeugen, Medien und Materialien. Hand-outs werden verteilt, Materialien können ausprobiert werden.
Do 03.12.2026
Night Migration Recording – Erfahrungen zum nächtlichen Vogelzug
Leo Wilhelm / Jena
20:00 Uhr Seminarraum 306, Uni-Jena, Zeiss-Campus
Hier gibt es weitere Inhalte:
Hilfe für Vögel: Was wie zu tun ist, an wen man sich wenden kann etc.
Tipps für Einsteigende: Hinweise zu Materialien und Methodik
Logbuch der Fachgruppe: hier sind die wichtigsten Aktionen der FG vermerkt.
Wasservogelzählung: 3 mal im Jahr, ideal für den Einstieg in die Ornithologie – gemeinsames Wandern, Entdecken, Kennenlernen. Keine Vorkenntnisse erforderlich, wetterfeste Kleidung und Fernglas empfohlen, Ausstieg/Unterbrechung jederzeit möglich.
Beobachtungsberichte: Beobachtungen aus Jena/SHK – ACHTUNG: Vorgaben zur Datenaufbereitung beachten!
Weiterführende Informationen finden sich auch hier:
ornitho.de … ornitho.de – vielseitig nutzbares Portal des Dachverbandes Deutscher Avifaunisten (DDA) – hier kann jede und jeder mitmachen!
Dieses frei zugängliche Datenbanksystem bietet eine ganze Reihe von Möglichkeiten von kaum schätzbarem Wert:
- Stets abrufbare Auflistung eigener (geprüfter) Daten: Datum, Ort, Art, Anzahl, Geschlecht etc. einschließlich weiterer Bild- oder Ton-Dateien
- Individuell einrichtbare Abfragen z.B. von Meldungen aus bestimmten Regionen, zu bestimmten Arten, Seltenheiten
- Kontaktaufnahme zu Ornithologinnen und Ornithologen deutschlandweit (wenn hinterlegt)
- Informationen zu saisonalen Besonderheiten
